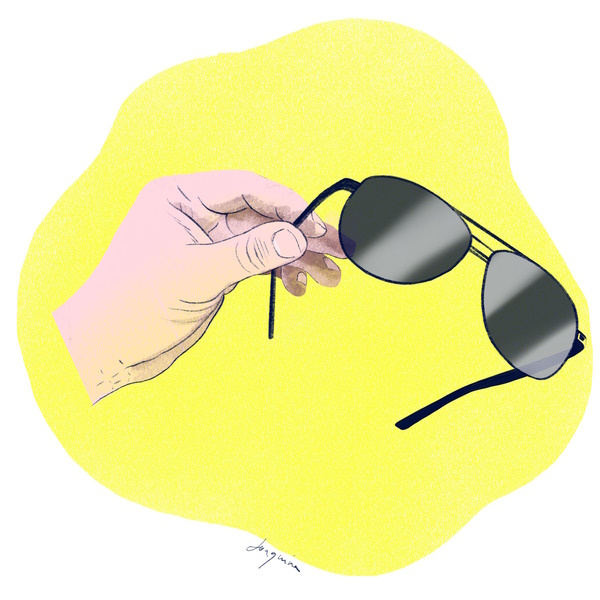«Sehen Sie jetzt, was das für Folter ist?», schreie ich den jungen Pfleger an, der mir einmal etwas Nettes getan hatte, und deute mit dem Kopf auf die Tür der Isolationszelle. Durch den Flur bugsiert ein anderer Pfleger gerade eine Mitpatientin. «Hier können Sie sich erstmal ausruhen», raunt er ihr zu, während er ihr die Tür zu einem normalen Zimmer aufmacht.
Eben krümmte sie sich noch mit schmerzverzerrter Haltung über das Geländer, das hier die Wände des Flurs säumt. Einen Arm hielt sie vor das Gesicht, um die Augen vor dem Licht zu schützen. Jedenfalls glaube ich, dass es das Licht war, vor dem sie sich schützen wollte. Das Licht und alles, was aus der Weite des Raumes optisch auf uns zuströmt, beim Rauskommen aus der Isolationszelle und in der Zeit danach. Aus Erfahrung und Beobachtung weiß ich, dass eine Sonnenbrille da ein bisschen helfen kann, jedenfalls bei manchen von uns. Aus diesem Grund auch, vermute ich, zirkuliert auf der Station eine beträchtliche Anzahl von Sonnenbrillen. Ich rannte schnell in mein Zimmer, um eine zu holen, und hielt sie der über dem Geländer kauernden Leidensgenossin hin. Aber sie wollte sie nicht nehmen. Sie machte sogar eine abwehrende Geste in meine Richtung. Wer weiß, wie sie mich und die Sonnenbrille wahrgenommen hat.
In den Stunden davor war ich Zeugin ihrer Isolierung geworden. Durch die offene Tür des kleinen Zimmers neben der Isolationszelle sah ich an ihrem Beobachter vorbei durch sein Fenster in die Zelle, wie sie dort auf dem Boden saß. Vielleicht auch auf der Matratze – so genau konnte ich das nicht sehen. Sie wollte Wasser für ihre Füße, die in schweren, schwarzen Schnürstiefeln steckten. Für mich war es alles leicht zu erraten: Sie muss in der Zelle kalte Füße bekommen und sich die Stiefel angezogen haben, die dort herumstanden. Dann müssen ihre Füße angeschwollen sein, und jetzt bekam sie sie nicht mehr aus den Stiefeln heraus, und außerdem schmerzten sie. Da sollte das Wasser ein bisschen Erleichterung bringen.
Dem Beobachter waren solche Nöte anscheinend völlig fremd, jedenfalls hörte er sich das Betteln nach Wasser ungerührt an, obwohl eine Kiste Mineralwasserflaschen neben ihm stand. Nachdem ich das eine Weile vom Flur mitangesehen hatte, rief ich ihm mit klopfendem Herzen aus gebührendem Abstand zu:
«Geben Sie es ihr doch einfach!»
Da wandte er sich zu mir und erklärte freundlich, dass er ihr doch schon zwei ganze Flaschen gegeben hatte. Und außerdem würde sie das Wasser sowieso nur über ihre Füße schütten. Er war sehr entspannt, als freute er sich über die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass jemand versteht, warum er es so macht, wie er es macht, und als müsste er nur lange genug reden – und er hatte ja Zeit –, damit ich begreifen würde, dass er es schon richtig macht, so, wie er es macht.
«Ich war ja auch da drin…», unterbrach ich ihn, mit vielsagendem Blick auf die Zelle. Ich weiß also wohl besser als er, dass sie schon ihre guten Gründe haben wird und er ihr einfach geben soll, wonach sie fragt. Aber er blieb fest bei seiner Logik, und ich spürte, wie etwas in mir hochstieg und gleich mein schnelles Herzklopfen in einer Woge mit eigener Dynamik mitnehmen würde. Und ich wusste: Ich muss weg hier.
Weg geht nicht, auf der geschlossenen Station. Aber um die Ecke und ans Ende des Flurs bewegte ich mich, sodass die Isolationszelle aus meinem Blickfeld und das Gespräch mit dem Beobachter abrupt beendet war. Dort tat ich mein Bestes, mich zu beruhigen.
Wie gesagt, der junge Pfleger hatte mir einmal etwas Nettes getan, und das ist deshalb wichtig für diese Geschichte, weil ich ihn sonst bestimmt nicht so offenherzig angeschrien hätte. Er hatte mir das Mittagessen ins Zimmer gebracht, als es mir einmal abgrundtief ging. Ich hatte mich gefragt, ob er das irgendwie bemerkt und mir deshalb das Essen ins Zimmer gebracht hatte, oder ob es ein Zufall war. Ich hatte ihn davor noch nie gesehen – was nichts heißen muss, aber zumal er auch so jung aussah, dachte ich, er könnte vielleicht ein Praktikant oder Pflegeschüler sein, der noch nicht wusste, dass das Essen hier normalerweise nicht ins Zimmer gebracht wurde, sondern im Flur auf dem Essenswagen steht.
Oder vielleicht verstand ja auch nur ich nicht, warum das Essen manchmal ins Zimmer gebracht wurde und manchmal in den Flur. So wie ich so vieles hier nicht verstand. Ich wollte auch gar nicht erst zu viel über alles nachdenken – ich wollte ja hier raus und nicht mich hier einleben –, aber so manche Versuche, irgendwelche Zusammenhänge auszumachen, stellten sich eben trotzdem ein.
Jedenfalls war es nicht nur, dass jener junge Pfleger mir mal etwas Nettes getan hatte, sondern auch meine Überlegung, dass er neu auf der Station und noch nicht zu hundert Prozent ihr zugehörig sein könnte, weswegen ich mich ihm zuwandte. Er war eigentlich mit etwas anderem beschäftigt, und nur meine Stimme, die ich ihm entgegenschleuderte, zwang seine Aufmerksamkeit für einen Moment zur Isolationszelle hin: «Sehen Sie jetzt, was das für Folter ist?»
«Hier wird nicht gefoltert», ruft er mir zurück, während er weitereilt. Und als er schon fast fort ist: «Hier ist Deutschland! Hier wird nicht gefoltert.» Damit sind jegliche Zweifel ob seiner Zugehörigkeit weg. Oh ja, er ist Teil dieser Station! Und nein, er sieht es nicht, was hier passiert. Ich mache meinen Mund wieder zu, japse innerlich nach Luft und wende mich den Wänden zu. Oh, können diese Wände Zeuginnen sein?
Worte bieten sich zaghaft als Gedanken an, mit dem Hauch einer Fantasie, wie es wäre, irgendwann und irgendwo meinen Verbündeten außerhalb dieser Wände zu beschreiben, was hier drinnen passiert. Die frisch ausgesprochenen Worte des jungen Pflegers hängen noch in der Luft. «Pinkwashing» fällt mir ein. Aber nein, das passt nicht. Es geht ja nicht um Queers, die den guten Namen abgeben, um das Ungeheuerliche zu verleugnen. Wie ist es mit «Deutschland-Washing»? Man hält den guten Namen Deutschland hoch, und schon steht fest, dass hier nicht gefoltert wird. Passt das?
Müde denke ich Worten wie diesen hinterher.
Es sind Worte, die mich mal verbanden mit aktivistischen Stellungnahmen und akademischen Schriften – früher, während meiner USA-Zeit, während meiner Promotion. Worte, mit denen wir Protest einlegten und Wissen schufen, in der Tradition radikaler sozialer Bewegungen. Worte, die manchmal gleichzeitig intellektuelle Überlegenheit unter Beweis stellen sollten für eine Universität, die ganz anderen Prinzipien verpflichtet ist. Worte, die Interesse wecken und Aufmerksamkeit bündeln sollen.
Da streift mich das Bewusstsein, dass das, was hier passiert, zu einfach ist, als dass sich darüber eine interessante Analyse machen ließe. Und dieses Bewusstsein verdampft in die Trost- und Bodenlosigkeit, die hier alles durchzieht wie die Luft, die wir atmen.
Wir sind nicht Teil der Welt.
«Wie lange bist du schon hier?»
Ich suche das Gespräch mit meiner Zimmernachbarin.
«Ist doch egal, oder?», schnaubt sie zurück.
Ich beeile mich, ihr beizupflichten, auch wenn ich nicht genau verstehe, warum. Aber vielleicht ist sie schon lange hier; und es ist bestimmt nicht schön, daran erinnert zu werden.
Ich sitze im Bett und blinzle. Sie steht am Fenster und atmet. Ich bin dankbar, dass noch etwas Lebendes im Raum ist.
Nach einer Weile setze ich unbeholfen noch einmal an.
«Willst du hier raus?»
«Blöde Frage…», antwortet sie, und kichert dabei auf ihre eigene Art. Vielleicht kichert sie auch nicht. Es klingt, als würde sie schnell viel Luft aus sich rausdrücken. Neulich habe ich sie gefragt, ob das schön für sie ist, wenn sie kichert. Da hat sie mich nur mit großen Augen angeschaut, und ich habe mich gefragt, ob das für sie überhaupt ein Kichern ist. Ein anderes Mal hat sie mich gefragt, warum ich so komisch kucke. Da wusste ich auch nicht, was ich sagen soll, und fragte nur: «Wie kucke ich denn?», aber das konnte sie mir dann auch nicht sagen.
Ich rutsche in die Seitenlage, kuschele mich unter die Decke und dämmere weg.
Auf der offenen Station sammeln wir uns um die Aschenbecher vor dem Eingang. Die, die rauchen, rauchen. Die, die nicht rauchen, stehen dabei. Ein paar junge Leute sitzen auf dem Boden und tauschen sich über ihre Schlafprobleme aus. Im Hintergrund ertönen Schreie und Hilferufe. Den ganzen Tag hören wir sie schon. Vielleicht auch den Vortag schon – da unterscheiden sich die Erinnerungen. Sebastian, der neu ist und so gut Tischtennis spielt, obwohl er nur einen Arm hat, findet die meisten Worte, sich darüber zu empören, was hier passiert. Er schwingt die Sätze, als habe er gerade das Unrecht der Welt entdeckt. Ich wende mich von ihm ab. Meine Blicke treffen sich mit Ahmeds, der am Rand der Gruppe steht und sich von einem Bein auf das andere wiegt.
«Wollen wir ihn suchen gehen?»
«Komm, wir suchen ihn!»
Schon gehen wir zusammen los. Auf dem Gelände sind viele Gebäude verstreut. Es gibt neben der Station, auf der ich eingesperrt war, auch noch eine andere Geschlossene; das weiß ich inzwischen. Wir folgen unseren Ohren. Bald sind wir vor einem mehrstöckigen Gebäude angekommen. Die Eingangstür lässt sich öffnen und führt in ein leeres Treppenhaus. Mit festen Schritten steigen wir eine Stufe nach der anderen nach oben. Ahmed pupst beim Treppensteigen laut, aber wir verziehen keine Mine. Mir könnte es genauso passieren, denn Kraft, um meinen Körper zusammenzuhalten, habe ich keine. In jeder Etage drücken wir die Türklinke nach unten. Aber die Metalltüren, die vom Treppenhaus abgehen, bleiben zu. Wieder draußen identifizieren wir das gekippte Fenster, aus dem die Schreie kommen, und positionieren uns darunter.
«Hallo! Hallo, hörst du uns?»
«Hilfe, ein Überfall! Ruft die Polizei!», ruft es von oben, wieder und wieder.
«Bist du fixiert?», schreit Ahmed nach einer Weile.
«Ja!», kommt die Antwort. Dann ist es erstmal still.
«Das war ein Überfall! Ruft die Polizei!», tönt es wieder von oben.
«Du bist in der Psychiatrie! Die Polizei würde hierher nicht kommen!» schreie ich, so laut ich kann, zurück.
Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und wir lassen Sätze rauf und runter fliegen.
«Wir gehen jetzt wieder!», rufen wir schließlich. Dann gehen wir schweigend nebeneinander über das Klinikgelände.
→ Johanna Rothe arbeitet in einer Kontakt- und Beratungsstelle und als Schriftstellerin.
Illustration: → Joaquina Garrote Gasch